
Einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über Flucht, Vertreibung und Integration leistet die bis zum 4. Dezember 2024 im Wiesbadener Haus der Heimat gezeigte Ausstellung „Ungehört – die Geschichte der Frauen“. Die Plakatausstellung beleuchtet das weitgehend unerzählte und oft übersehene Schicksal der vertriebenen und flüchtenden Frauen der Jahre 1944/1945. Während ihre Männer noch im Krieg waren, gefallen oder bereits in Gefangenschaft saßen, waren sie es maßgeblich, die die Flucht organisierten, realisierten und die Neuorientierung in Westdeutschland für sich, ihre Kinder und Familien unter den schwierigsten Bedingungen eines zerstörten Deutschlands erfolgreich bewältigten.
Die Flüchtlingsfrauen waren selbstbewusst: Auf ihren Schultern ruhte maßgeblich das Schicksal ihrer ganzen „vaterlosen“ Familien, mit denen sie unter den härtesten Bedingungen des Jahrhundertwinters 1944/45 die „Reise“ ins Ungewisse antraten – zu Fuß, in Leiterwagen, in Trecks mit Pferdewagen, mit Schiffen oder Pferdeschlitten/-wagen über die zugefrorene Ostsee oder, wenn sie Glück hatten, in den letzten Zügen, die jedoch häufig von der englischen Luftwaffe beschossen wurden. Es waren Mütter, Großmütter, Schwestern und Tanten, die diese Verantwortung für ihre Familien wie selbstverständlich übernahmen, ohne dass darüber groß gesprochen wurde.
Für viele dieser Frauen war es später schwer, über die erlebten Traumata, Verluste und Herausforderungen zu sprechen, auch weil die politische Situation ab den 1960er-Jahren Heimat- und Ostvertriebene eher als „rechte Ewiggestrige“ stigmatisierte. Damit verstummten die Frauen zusehends, und ihre Geschichten gerieten in Vergessenheit; und als Zuhörer kamen ohnehin weitestgehend nur diejenigen, die die Geschichten und die Komplexität dieser Thematik kannten. Die Ausstellung würdigt deshalb speziell die Erfahrungen und Leistungen dieser Frauen, die in der Öffentlichkeit oft wenig Beachtung fanden.
Im Zentrum der Ausstellung stehen stellvertretend für all diese tapferen Frauen die Geschichten von sechs Zeitzeuginnen, die aus verschiedenen Regionen des östlichen Europas und der ehemaligen deutschen Ostgebiete stammen. Ihre Lebenswege in den Kriegs- und Nachkriegsjahren zeigen trotz vieler Parallelen auch individuelle Unterschiede und persönliche Besonderheiten. Diese sechs Frauen repräsentieren symbolisch die Erlebnisse vieler anderer, die ebenfalls ihre Heimat verlassen mussten und in eine ungewisse Zukunft aufbrachen. Die Ausstellung stellt nicht nur ihre Verluste und Leiden in den Vordergrund, sondern auch ihre bemerkenswerte Stärke, Anpassungsfähigkeit und den Beitrag, den sie zum Wiederaufbau und zur Integration leisteten.

Das Nazi-Verbrechen die Menschen an rechtzeitiger Flucht zu hindern
Eine kaum thematisierte Fluchthürde war zudem das Verbrechen der Nazi-Führung, Millionen Menschen in den deutschen Ostgebieten noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zu zwingen, in ihren Ortschaften zu verbleiben, und zwar selbst als die Rote Armee schon schnell und hörbar vorrückte. Aus Angst vor Chaos und Desertion, aber auch, um den Angreifern ihr Vordringen möglichst zu erschweren, verbot die deutsche Wehrmacht den zivilen Bewohnern, ihre Heimat rechtzeitig zu verlassen. Wer dennoch floh, riskierte harte Strafen, sogar standrechtliche Erschießungen.
Diese absolute Residenzpflicht war mit einer eigentlichen Gründe dafür, weshalb die vom anrückenden Feinde bedrohten Menschen kaum Zeit hatten, ihre Flucht überhaupt vorzubereiten. Es gab weder Fluchtlotsen, Fluchthelfer, noch sonstige rechtliche Unterstützung und Unterkunftsziele im Westen. Handy und andere moderne Kommunikationsmittel waren unbekannt. So wusste niemand, wo der andere war, falls Familien auseinander gerissen wurden. Das alles können sich Kinder, Enkel und Urenkel der Flüchtlingsgeneration heutzutage gar nicht oder – über den Umweg heutiger dramatischer Flüchtlingsgeschichten – nur wenig realistisch vorstellen.
Wie rasch Mensch jedoch wieder in solche oder ähnliche Situationen von Flucht und Vertreibung geraten können, sehen und hören wir täglich in den Nachrichten.
Die besondere Rolle der Frauen während Flucht und beim Wiederaufbau (Stichworte)
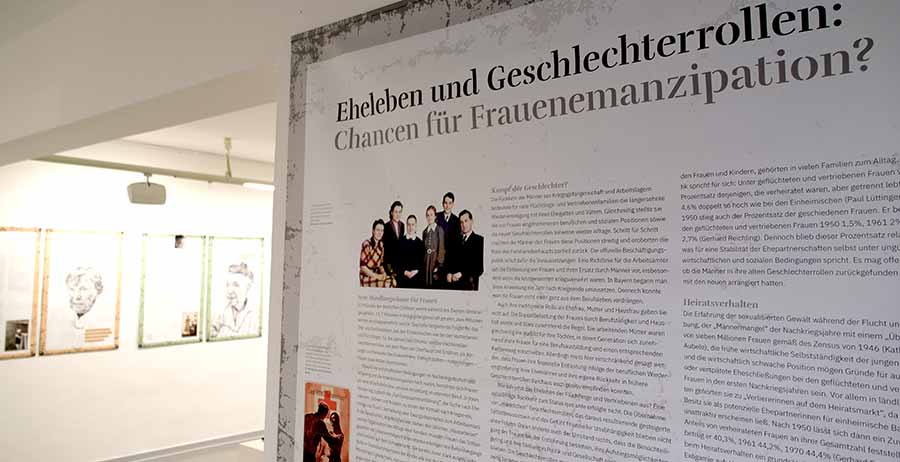
Eine ganz besondere Rolle der Frauen bei Flucht und Vertreibung
Frauen spielten eine zentrale Rolle während der Flucht und Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten sowie beim Wiederaufbau Deutschlands nach 1945. Diese Zeit stellte sie vor immense Herausforderungen, da sie oft ohne die Männer der Familie, die im Krieg gefallen, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft geraten waren, die Verantwortung für ihre Familien übernehmen mussten.
Hauptverantwortung für die Familie:
Da viele Männer noch an der Front waren oder bereits gefallen waren, lag die Verantwortung für die Organisation der Flucht und das Überleben häufig bei den Frauen. Sie mussten entscheiden, was sie auf die Reise mitnehmen konnten und wie sie ihre Kinder sowie ältere Familienangehörige auf den langen und gefährlichen Fluchtwegen versorgen konnten. Viele waren nicht nur für ihre Kinder, sondern oft auch für Nachbarn und Verwandte verantwortlich.
Schutz vor Gewalt und Übergriffen:
Die Flucht war von großer Unsicherheit und zahlreichen Gefahren begleitet. Frauen waren häufig Übergriffen, insbesondere sexualisierter Gewalt, ausgesetzt. Die Rote Armee, die die Gebiete besetzte, verübte in vielen Fällen Gewalt gegen die deutsche Zivilbevölkerung. Frauen mussten daher nicht nur für die Grundversorgung, sondern auch für den Schutz ihrer Kinder und ihrer selbst sorgen.
Resilienz und Durchhaltevermögen:
Frauen entwickelten enorme Kräfte und Kreativität, um in dieser schwierigen Lage für die Sicherheit und Ernährung ihrer Familien zu sorgen. Häufig standen kaum Verpflegung oder Unterkunft zur Verfügung, Krankheiten drohten, und tagelange Märsche bei Winterkälte mussten bewältigt werden. Die Belastung war immens, viele verloren Angehörige oder litten selbst unter Krankheiten und Erschöpfung.
Frauen als Säulen des Wiederaufbaus
Nach ihrer Ankunft in den westlichen Besatzungszonen und in Westdeutschland spielten Frauen eine unverzichtbare Rolle beim Wiederaufbau des Landes. Viele Männer waren noch in Kriegsgefangenschaft oder kehrten verletzt und traumatisiert zurück, sodass Frauen oft allein für das Familieneinkommen und den Haushalt verantwortlich waren.
- Wiederaufbauarbeit („Trümmerfrauen“) und Versorgung der Familien:
Die sogenannten Trümmerfrauen wurden zum Symbol des Wiederaufbaus. Sie räumten in den zerbombten Städten Schutt weg, sortierten brauchbares Baumaterial und trugen so maßgeblich dazu bei, dass das zerstörte Deutschland wieder bewohnbar wurde. Die körperlich harte Arbeit in den Ruinen war für viele Frauen die einzige Möglichkeit, Geld oder Nahrungsmittel für die Familie zu verdienen. - Wirtschaftlicher und sozialer Einsatz:
Viele Frauen übernahmen Arbeiten, die zuvor als „Männerarbeit“ galten, und trugen zum Wiederaufbau der lokalen Wirtschaft bei. Sie arbeiteten in Landwirtschaft, Fabriken oder im Dienstleistungssektor und halfen so, die Wirtschaft langsam zu stabilisieren. Die Erfahrungen von Vertreibung und Nachkriegsarmut machten Frauen besonders anpassungsfähig und erfinderisch. - Neugestaltung der Familienrollen:
Die Erfahrungen von Flucht, Vertreibung und Krieg prägten die Frauen nachhaltig. Sie entwickelten Fähigkeiten, die ihnen in der traditionellen Familienstruktur zuvor oft verwehrt waren, und übernahmen zentrale Rollen in familiärer Führung und Entscheidungsfindung. Die Notwendigkeit, ohne männliche Unterstützung den Alltag zu bewältigen, stärkte ihr Selbstbewusstsein. - Bewahrung der Familiengeschichte und Weitergabe der Erfahrungen:
In der Nachkriegszeit wurden Frauen oft zu Bewahrerinnen der Familiengeschichte und der Erfahrungen der Vertreibung. Sie gaben Erinnerungen und Erlebnisse an Kinder und Enkel weiter und prägten so das kollektive Gedächtnis.
Aufnahmebereitschaft und neue Impulse
Es sei an dieser Stelle auf die großartige Leistung der westdeutschen Bevölkerung hingewiesen, die trotz eigener größter Not Millionen Menschen aufnahm. Letztlich wurde dies zu einer Erfolgsgeschichte, da die Flüchtlinge, wie man sie damals nannte, sehr leistungsorientiert und motiviert waren, gemeinsam das Land wieder aufzubauen.
(Diether von Goddenthow/ RheinMainKultur.de)
