
Mit „Rembrandts Amsterdam – Goldene Zeiten?“ (27.11.24 – 23.3.25) gelingt dem Frankfurter Städel Museum eine grandiose Fortsetzung der unvergesslichen Rembrandt-Show „Nennt mich Rembrandt – Durchbruch in Amsterdam“. Ging es 2021/22 darum, die entscheidenden ersten Karrierejahre des jungen Rembrandt aufzuzeigen, rückt das Städel-Museum jetzt die zu Rembrandts Zeiten wie keine andere boomende europäische Welthandelsstadt Amsterdam ins Zentrum der Betrachtung.
Eine einflussreiche Bürgerschaft prägt die Geschicke der Stadt, festgehalten in bedeutenden Gemälden der größten niederländischen Meister. Allen voran Rembrandt Harmensz van Rijn, aber auch die Künstler Jacob Backer, Ferdinand Bol, Govert Flinck, Bartholomeus van der Helst, Nicolaes Eliasz Pickenoy, David Vinckboons oder Jan Victors spiegeln in Amsterdamer Gruppenbildnissen das Selbstverständnis der bürgerlichen Stadtgesellschaft.

Im Mittelpunkt von „Rembrandts Amsterdam – Goldene Zeiten?“ stehen die herausragenden Gruppenbildnisse des Amsterdam Museums, die höchst selten ausgeliehen und in diesem großen Umfang erstmals in Deutschland zu sehen sind.
Zu verdanken ist dies dem einmalig glücklichen Umstand, dass das Amsterdam Museum renoviert wird. Nur so sei es „überhaupt möglich gewesen, diese Gruppenporträts der unterschiedlichen Gilden, der unterschiedlichen Regenten und Regentinnen in einer solchen Qualität und Dichte nach Frankfurt zu bekommen“, freut sich Städel Direktor Philipp Demandt. Dabei handele es sich um „die Ikonen der niederländischen Nationsbildung, die in einer solchen Fülle nie die Niederlande verlassen“.

In Frankfurt werden rund 100 Gemälde, Skulpturen und Druckgrafiken sowie kulturhistorische Gebrauchsgegenstände präsentiert, ergänzt und vereint aus weiteren führenden niederländischen und internationalen Museen, darunter Meisterwerke aus dem Rijksmuseum in Amsterdam, dem Metropolitan Museum of Art in New York, dem Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen oder dem Muzeum Narodowe in Warschau sowie aus dem großen Eigenbestand des Städel Museums. Museumgründer Johann Friedrich Städel war bekanntermaßen ein glühender Verehrer der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts. Er habe, so Demandt, „eine große Sammlung, unter anderem auch von Rembrandt zusammengetragen, so dass wir heute 259 Werke von Rembrandt im Städel-Museum besitzen“. Die niederländische Kunst spielt bei den Bürgern in Frankfurt im späten 18. Jahrhundert eine ganz große Rolle. Beides waren große Handels- und selbstverwaltete Bürger-Städte, und oftmals wurden die Söhne von Handels- und Bankhäusern nach Amsterdam zur Ausbildung gegeben, die niederländische Malerei an den Main brachten. Insofern spiele die Auseinandersetzung mit der niederländischen Kunst auch in der eigenen Institutionsgeschichte und Ausstellungs-Historie des Städel Museums eine ganz große Rolle, betont der Städel-Direktor.
Erfolg war Zeichen eines gottgefälligen Lebens

Die Ausstellung beginnt mit Werken aus der Zeit nach der Machtübernahme der protestantischen Eliten 1578 in Amsterdam vor dem Hintergrund des 80jährigen Krieges gegen die spanischen Besatzer der Niederladen. Mit der Absetzung und Vertreibung der bis dahin katholischen Oberschicht wurden die katholischen Einrichtungen in Amsterdam, darunter 20 Klöster, funktionslos. „Der Wegfall der zuvor durch die Einrichtungen der katholischen Kirche geleisteten Fürsorge und Unterstützung der Armen und Kranken sollte sich angesichts des rasanten Bevölkerungswachstums Amsterdams bald schmerzlich zeigen“, erläutert Sander.
Der Wechsel vom bislang katholischen Glauben zum Protestantismus calvinistischer Prägung hatte noch eine zweite Ebene: Während für Katholiken Armut zwar auch Gottesschicksal war, aber eine Chance bot, durch Almosengaben, selber etwas für’s eigene Seelenheil tun zu können, galt Armut bei den calvinistischen Protestanten eher als ein Zeichen eines weniger gottgefälligen Lebens. Reichtum war bei Protestanten calvinistischer Prägung Ausdruck eines gottgewollten richtigen Lebens: Wirtschaftlich erfolgreich zu sein, war ein göttliches Zeichen dafür, dass Gott bei mir ist. „Ich bin wirtschaftlich erfolgreich, also führe ich ein gottgefälliges Leben!“
Anfänge des Resozialisierungsgedankens

Der calvinistisch-protestantische Leistungsgedanken führte insbesondere auch zu einem Paradigmenwechsel im Umgang mit „Bedürftigen“ und „Straffälligen“: Anstatt diese Menschen im Sinne der katholischen Armenfürsorge „nur“ zu versorgen oder gar aus der Stadt zu treiben, reifte bei den Calvinisten der Gedanke, diese Menschen besser für die Gemeinschaft arbeiten zu lassen und ihnen hierdurch eine Chance zu geben, doch noch in ein gottgefällig(er)es Leben zurück finden zu können. In dieser Haltung liegen die Anfänge des „Resozialisierungs-Gedankens“, eines Sozial-Ansatzes, der für uns heutzutage selbstverständlich ist. Weil man also der wachsenden Zahl Bedürftiger Herr werden musste, „wurden nach und nach viele bisherige Klöster unter städtischer Aufsicht in Sozial- und Disziplinareinrichtungen umgewandelt, die bald in ganz Nord- und Westeuropa Vorbildfunktion haben sollten. Sie wurden von Angehörigen der protestantischen Stadtelite ehrenamtlich als Vorsteher (und teilweise auch als Vorsteherinnen; regenten und regentessen) geleitet“, so Sander. Die neuen Einrichtungen waren beispielsweise: Das Bürgerwaisenhaus (Burgenveeshuis), hier fanden jedoch Waisen von Eltern mit Amsterdamer Bürgerrecht Obdach, Verpflegung und Ausbildung. Daneben gab es an die 19 Almosen-Waisenhäuser, die die Jungs, sobald sie alt genug waren, zu 80 Prozent auf den Handelsschiffen der Ostindischen und Westindischen Kompanie einsetzen, von denen wohl lediglich 50 Prozent zurückkamen. Es entstand das Männerzuchthaus (Rasphuis), das Frauenzuchthaus (Spinhuis), und Räumlichkeiten für die Dichtergilde (De Egelantier und die snijkamer) sowie ein Sektionsraum für die Chirurgengilde. Hinzu kamen Almosen-Häuser (für unverschuldet in Not Geratene, die trotz Wohnsitz ohne Hilfe nicht über die Runden kamen), Obdachlosenunterkünfte und Altenpflegeheime.

In diesen Zuchthäusern mussten Gefangene gezwungener Maßen arbeiten, jedoch mit dem Leitgedanken, dass diese hierdurch wieder einem gottgefälligeren Leben und der Gesellschaft zugeführt werden konnten. Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass im boomenden Amsterdam jede Arbeitskraft gebraucht wurde.
Bald zeigte sich, dass die ehrenamtliche Tätigkeit als Regent ein Schlüssel zum Erringen wichtiger Positionen innerhalb der Stadtführung wurde, zu hohem Ansehen führte und vor allem neue Möglichkeiten bot, sich gesellschaftlich zu präsentieren. Dieses kollektive Repräsentationsbedürfnis spiegelt sich in einem neuen Bildtypus wider, der unter anderem nach Vorbildern der Schützengilden-Bilder gemalt wurde. Wie die Schützen ihre Gruppenbildnisse an ihren Übungsstätten aufhängten und diese zu repräsentativen Versammlungsorten für die patrizische Bürger-Elite der Stadt machten, verfuhren nun auch die Regenten mit ihren Vorsteher- und Regentenbildern. Ab dem frühen 17. Jahrhundert schmückten die Regentenporträts die Verwaltungs- und Versammlungszimmer der jeweiligen Einrichtungen.
Wer ist „bildniswürdig“ und wer ist „Attribut“
Das Städel Museum zeigt diese im 17. Jahrhundert neu hinzu gekommenen Gruppenporträts der Vorsteher und Vorsteherinnen der neuen Amsterdamer Fürsorge-Institutionen neben den Bildnissen von Schützen-Gilden und Handwerks- und Chirurgen-Gilden. Diese Werke sind jedoch nicht nur ein Spiegel der neuen protestantischen Oberschicht, sondern zeigen auch Menschen und Gestalten eher am Rande.

Der Bildaufbau der Regentengruppen-Bilder führte die Kuratoren zu zahlreichen Fragestellungen: Wer war der „Gewinner“? Wer der „Verlierer“? Wer war „bildnisfähig“ oder „bildniswürdig“? Wer verfügte über die beträchtlichen Mittel, um ein Bild anfertigen zu lassen? Und wer hatte überhaupt die Gelegenheit, ein eigenes Porträt innerhalb seiner Gruppe zeigen zu können?
Ein zentraler Punkt war zudem die Überlegung: „Wie können wir es schaffen, nicht nur diese glanzvollen Gruppen der Oberschicht zu zeigen? Wie können wir, oft auf indirekte Weise, Personen eine visuelle Präsenz in der Ausstellung verleihen, die in ihrer Zeit per Definition niemals porträtiert worden wären?“ schildert der Kurator die Herangehensweise.
Im Mittelpunkt stand somit die Frage: „Wie können wir Bilder finden, in denen auch Menschen porträthaft erscheinen, die in dieser Zeit eigentlich überhaupt nicht für eine Porträtdarstellung infrage kamen?“
Bei der Prüfung habe sich gezeigt, dass diese „nichtbildnisfähigen“ Personen auf Bildern existieren. Sie erscheinen jedoch auf den Regentenbildern nicht als „Porträtierte“, sondern als „Attribute“. Die dargestellten Bedürftigen, Waisen und Alten sind eher schmückendes Beiwerk, das die „gute Tat“ der Porträtierten unterstreichen soll.
Die Ausstellung kann somit auch als eine Gesellschaftsstudie ganz besonderer Art verstanden werden. Einzelheiten und Erkenntnisse dazu können in den Texttafeln /Wandtexten der Ausstellung, über Audio-Guides und im empfehlenswerten Begleitkatalog zur Ausstellung nachgelesen werden.
Ausstellungrundgang – Mit Ankerfiguren durchs Goldene Zeitalter

Die Ausstellung „Rembrandts Amsterdam. Goldene Zeiten?“ fächert sich in verschiedene Themen-Facetten, die sich über zwei Stockwerke verteilen. Sie beginnt im Untergeschoss des Ausstellungshauses im Raum „Amsterdam ‚Boomtown‘ des 17. Jahrhunderts“ mit beeindruckenden Darstellungen von Amsterdam in einer Zeit des außergewöhnlichen Wandels und Wachstums.
Werke wie Nicolaes Pietersz. Berchems Allegorie auf die Stadterweiterung (ca. 1663), Johannes Lingelbachs Ansicht des Dam mit dem im Bau befindlichen neuen Rathaus (1656) und Job Adriaensz. Berckheyde’s Innenhof der Börse von Amsterdam (ca. 1670) spiegeln das neu gewonnene Selbstbewusstsein der Stadt wider. Sie zeigen, wie sich Amsterdam von einer kleinen Siedlung an der Amstel zu einer Welthandelsmetropole entwickelte, und verdeutlichen den Stolz und Wohlstand ihrer Bürger.
Es folgen – die auch räumlich gekennzeichneten Abschnitte – deren Titel Programm sind: „Aus reiner Barmherzigkeit? Die Gruppenporträts des Almosenhauses“, „In schwarz-roter Uniform – Amsterdams Waisenhäuser“, „Kopf an Kopf. Die frühen Schützenstücke“, „Bilder in XXL Die Schützenstücke der Rembrandtzeit“, „Die letzte Blüte des Amsterdamer Schützenstücks“, „Auf Messers Schneide. Zwischen Schaulust und Wissenschaft“, „Zur Schau gestellt – Der Fall Elsje Christiaens“, „Rembrandts Blick auf gesellschaftliche Außenseiter“, „Raspeln und Spinnen Amsterdams Zuchthäuser“ sowie „Aus eigenem Bestand. Rembrandt und seine Amsterdamer Malerkollegen im Städel Museum“.
Die Ankerfiguren von Elsje am Galgen bis

Eine Besonderheit – und neu – ist zudem, dass sieben Protagonisten des sogenannten Amsterdamer Goldenen Zeitalters als Ankerfiguren die Besucher in dieser Ausstellung begleiten: vom Millionär bis zum Bettler, vom Gewinner bis zum Verlierer, von der Dienstmagd bis zur Prostituierten. Die Ankerfiguren sollen dabei helfen, einen roten Faden durch diese Epoche zu spannen und ein umfassendes Panorama der Stadt Amsterdam im 17. Jahrhundert mit all ihrem Licht und Schatten abzubilden.
Zunächst begegnen wir der einflussreichen Investorin und Regentin Aechje Oetgens (1561–1639), dargestellt in dem Gemälde Die Regentinnen des Burgerweeshuis (1633/34) von Jacob Adriaensz Backer (1608–1651) und erfahren etwas über ihre wechselvolle Geschichte, aber auch darüber, dass es zu dieser – zwar männerdominierten – Zeit durchaus schon selbstbewusste mächtige Unternehmerinnen gab.
Einen Raum weiter folgt das erschütternde Schicksal der 18-jährigen Elsje Christiaens, deren hingerichteter, geschundener Leichnam auf der – dem Amsterdamer Hafen vorgelagerten – Galgeninsel Volewijk zur Schau gestellt und bis zum Abfaulen dem Vogelfraß preisgegeben wurde. Elsje, eine aus Dänemark eingewanderte junge Frau, hatte in einem Verzweiflungsaffekt ihre „Schlafmutter“ mit einer Axt erschlagen, als diese ihr nach einem Rausschmiss auf die Straße wegen unbezahlter Mietschulden ihre wenigen Habseligkeiten wegnehmen wollte. Mehrere Künstler hielten diesen bis heute in der Justizdiskussion zum Thema „Affekttat“ relevanten Fall aus verschiedenen Perspektiven fest.

Obwohl die Gastwirtin und Geschäftsfrau Geertruyd Nachtglas eigentlich nur als „angestellte Schankwirtin“ im Schützenhaus der Kloveniers (Hakenbüchsenschützen) knapp am rechten oberen Rand des Bildes Die Vorsteher des Hakenbüchsen-Schützenhauses (Kloveniersdoelen) (1655) von Bartholomeus van der Helst (ca. 1613–1670) zu sehen ist, ist ihre Erfolgsgeschichte hochspannend.
Der Verleger und Regent Isaac Commelin (1598–1676), der 1669 in Öl auf Leinwand von Gerbrand van den Eeckhout (1621–1674) festgehalten wurde, gehört zu den einflussreichsten Amsterdamer Persönlichkeiten der bürgerlichen Elite. Er war als Regent und Vorstand in mehreren städtischen Institutionen vertreten: im Nieuwezijds Huiszittenhuis (eine Einrichtung, die sich um Bedürftige kümmert, die noch in den eigenen vier Wänden leben), im St. Pietergasthuis (einem Krankenhaus) und auch in der Schouwburg (einem Theater).
Eine glücklich verlaufene Geschichte erzählt das Gemälde Der Künstler huldigt der Personifikation des Burgerweeshuis (Bürgerwaisenhauses) von 1684. Es handelt von dem Waisenkind und späteren Maler Jacob van der Sluis. Laut Wandtext erfahren wir mehr über sein Schicksal und Glück: Als elternloses Kind aus Leiden wurde er in einem Amsterdamer Bürgerwaisenhaus aufgenommen, dort ausgebildet und später ein erfolgreicher Künstler.

Neben der wechselvollen Geschichte des Aktmodells und der Muse Maria Jonas, alias Marie de la Motte, die Dirck Bleker (1622–1679/1702) 1651 in einem Auftragswerk als büßende Maria Magdalena festhielt, erzählen zusätzliche Skizzen davon, wie Kunststudenten zu Rembrandts Zeiten – als öffentliche Nacktheit als unschicklich galt – gemeinsam eine Prostituierte als Aktmodell bezahlten. Deshalb wird mitunter derselbe Akt aus mehreren Perspektiven dargestellt.
Auf den ersten Blick vielleicht etwas gruselig wirkend, erzählt das Gemälde Die Osteologie-Vorlesung von Dr. Sebastiaen Egbertsz (1619) von der Geschichte der Anatomie, der Bestrafung und der aufkommenden Mode, Anatomievorlesungen mit Essen und Trinken zu kleinen illustren gesellschaftlichen Ereignissen zu machen. Das ins Bildzentrum gerückte Skelett war das eines englischen Piraten, der nach seiner Hinrichtung der Anatomie überlassen wurde. Das Werk, mit dem Titel Der unbekannte Engländer – Pirat und Anatomiemodell, wird Werner van den Valckert (ca. 1580/85–ca. 1627) oder Nicolaes Eliasz. Pickenoy (1588–1650/56) zugeschrieben.

Man sollte für die Ausstellung Rembrandts Amsterdam. Goldene Zeiten? wirklich genügend Zeit einplanen, um – unterstützt von Audio-Guides und den Wandtexten – dieses grandios gezeichnete Panorama einer Epoche zu ergründen, deren Vorstellungen die Geschichte Amsterdams und der Niederlande bis heute prägen.
Katalog:
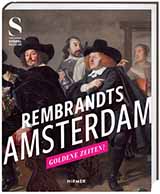 Der sehr empfehlenswerte, im Hirmer Verlag veröffentlichte Begleitkatalog „Rembrandts Amsterdam. Goldene Zeiten?“, herausgegeben und eingeleitet von Jochen Sander, enthält wichtige ergänzende Beiträge von Stephanie S. Dickey, Corinna Gannon, Norbert E. Middelkoop, Tom van der Molen, Astrid Reuter, Jochen Sander, Friederike Schütt und Kambis Zahedi. Er ist in einer deutschen und englischen Ausgabe erhältlich (280 Seiten, 181 Abbildungen, 49,90 Euro für die Buchhandelsausgabe, 39,90 Euro für die Museumsausgabe).
Der sehr empfehlenswerte, im Hirmer Verlag veröffentlichte Begleitkatalog „Rembrandts Amsterdam. Goldene Zeiten?“, herausgegeben und eingeleitet von Jochen Sander, enthält wichtige ergänzende Beiträge von Stephanie S. Dickey, Corinna Gannon, Norbert E. Middelkoop, Tom van der Molen, Astrid Reuter, Jochen Sander, Friederike Schütt und Kambis Zahedi. Er ist in einer deutschen und englischen Ausgabe erhältlich (280 Seiten, 181 Abbildungen, 49,90 Euro für die Buchhandelsausgabe, 39,90 Euro für die Museumsausgabe).
(Diether von Goddenthow /RheinMainKultur.de)
Weitere Informationen: staedelmuseum.de
Ort: Städel Museum, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main
Besucherservice und Führungen: +49(0)69-605098-200, info@staedelmuseum.de
Tickets: Di–Fr, Sa, So + Feiertage 18 Euro, ermäßigt 16 Euro; Dienstags-Special: jeden Dienstag 15.00–18.00 Uhr 9 Euro; freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren. Gruppen ab 10 regulär zahlenden Personen: 16 Euro pro Person. Für alle Gruppen ist generell eine Anmeldung unter Telefon +49(0)69-605098-200 oder info@staedelmuseum.de erforderlich. Sonderöffnungszeiten an Weihnachten, Silvester und Neujahr unter staedelmuseum.de. Early-Bird-Ticket 15 Euro, buchbar bis zum 10.11.24 und gültig für die ersten 11 Tage der Ausstellung (bis 8.12.24).
