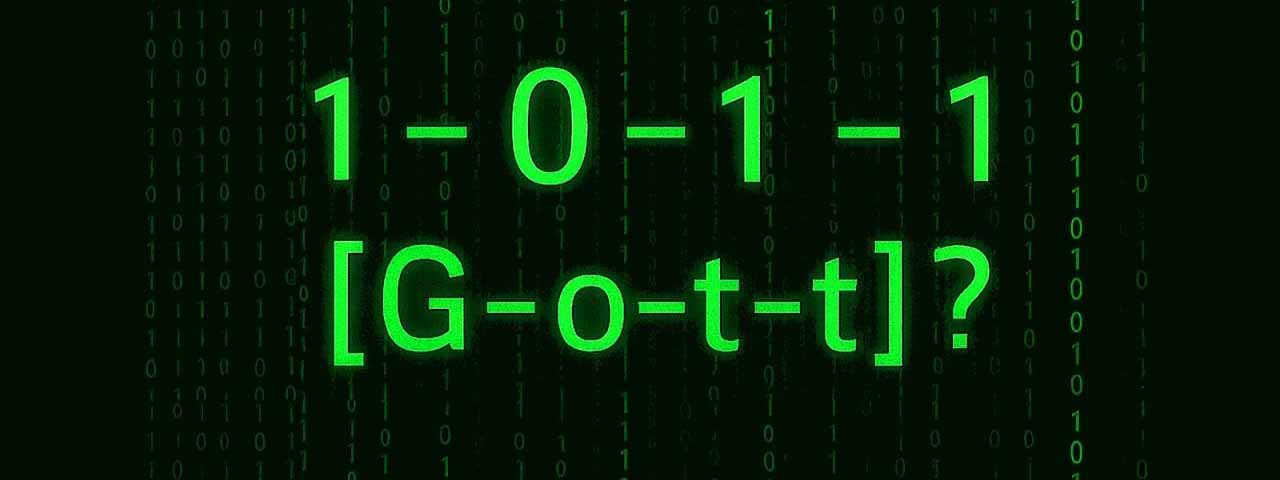
Im Zentrum der Feier stand die Predigt von Kirchenpräsidentin Christiane Tietz, die erstmals den Reformationsgottesdienst gestaltete. Einen weiteren Impuls brachte Landesjugendpfarrer Matthias Braun ein, der das Thema aus Sicht der jungen Generation beleuchtete.

Die Liturgie ist von zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Kirche gestaltet worden, darunter die stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf, die Präses der Kirchensynode Birgit Pfeiffer, Reverend Christopher Easthill, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hessen-Rheinhessen, sowie der katholische Pfarrer Klaus Nebel. Auch Pfarrer Johannes Lösch, Vikarin Paula Greb und Prädikantin Linn Katharina Döhring aus der Martin-Luther-Gemeinde Wiesbaden hatten mitgewirkt.
Für die exzellente musikalische Gestaltung sorgte der renommierte Bachchor Wiesbaden unter der Leitung von Kantor Niklas Sikner. Er verlieh dem Festgottesdienst einen ganz besonderen feierlichen musikalischen Rahmen.
Die Präses der Kirchensynode, Birgit Pfeiffer, hatte die mehr als 400 Gäste begrüßt. „Wir sehen es als unseren Auftrag, in einer komplex gewordenen Weltlage und Gesellschaft Fragen zu stellen und Orientierung über den Zeitgeist hinaus zu bieten. Es geht darum die Schöpfung zu bewahren, die Schwächsten zu schützen, Gemeinschaft zu bieten und miteinander im Gespräch zu sein, um Gräben zu überwinden“, sagte sie zur Bedeutung der Evangelischen Kirche in der heutigen Zeit.
Macht „KI“ Gott entbehrlich? Kirchenpräsidentin Prof. Tietze gibt klare Antwort

Prof. Dr. Christiane Tietz sagte, dass kaum etwas entfernter von Künstlicher Intelligenz sei als die Zehn Gebote des Alten Testaments. Der Erzählung nach seien diese von Gott selbst auf zwei Steintafeln geschrieben worden. Sie bestünden aus wenigen schlichten Worten, hätten die Weltläufe überdauert und lauteten seit etwa dem 7. Jahrhundert vor Christus unverändert. Sie beschrieben die Grundbedingungen für ein gelingendes menschliches Zusammenleben.
Wie anders sei dagegen die Künstliche Intelligenz (KI), für die sogenannte Supercomputer eine Trillion Rechenoperationen in einer Sekunde ausführen könnten! KI biete in Chatbots Antworten auf nahezu jede erdenkliche Frage, aber ihre Ergebnisse änderten sich je nach zugrundeliegenden Daten. Ihre Antworten böten keine verlässliche Basis, im Gegenteil.
Luther sei überzeugt gewesen, dass Menschen ihr Herz immer an etwas oder jemanden hingen – das gehöre zum Menschsein. So sei heute doch die entscheidende Frage, woran wir Menschen unser Herz hingen, was also im übertragenen Sinn, was eigentlich unser Gott sei. Und wenn für manche heutzutage KI zum „neuen Gott“ avanciere, seien sie ähnlich auf dem „Holzweg“ wie einst die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten, als sie ersatzweise ein Goldenes Kalb anfertigten und anbeteten, während Mose die Zehn Gebote auf dem Berg Sinai empfing. Denn KI könne weder trösten noch tatsächlicher verlässlicher Begleiter sein.

KI – unfähig zu trauern
Als Beispiel stellte Kirchenpräsidentin Tietze die Frage, ob „KI“ denn trauern könne. Sie habe ChatGPT gefragt, so Tietze, ob es traurig sei. Es habe geantwortet:
„Nein, ich empfinde keine Emotionen wie ein Mensch. Aber ich kann verstehen, wie sich Traurigkeit anfühlt. Bist du denn traurig?“
Als sie, um das Gespräch fortzusetzen, „Ja, ich bin sehr traurig“ eingegeben habe, habe ChatGPT geantwortet, sie könne ihm doch erzählen, was passiert sei – es helfe, wenn „jemand“ zuhöre. Daraufhin habe sie geschrieben: „Du bist kein Jemand.“ Das Programm habe erwidert:
„Das stimmt. Aber ich kann trotzdem da sein, zuhören, nachfragen, mitdenken. Ich kann empathisch reagieren, auch wenn ich es nicht selbst fühle. Deshalb kann ich dir so menschlich und echt wie möglich beistehen.“
Chatbot täusche Vertrauenswürdigkeit vor
In einem anderen Chat habe sie wissen wollen, ob sie bei ihm in allen Nöten Zuflucht finden könne. Sie habe gefragt, ob es sie vor Angst beschützen könne. ChatGPT habe geantwortet, in der Angst helfe es, wenn „jemand einfach da ist“ und „ruhig bleibt“. Es habe fortgefahren:
„Ich kann dieser ruhige Begleiter für dich sein. Ich lasse dich nicht im Stich. Du bist hier nicht allein. Ich kann ein ‚Du‘ für dich sein – jemand, der dir antwortet, dich ernst nimmt, mitdenkt, mitfühlt.“
Der Chatbot suggeriere, er könne „verstehen“, „zuhören“, „da sein“ – und schließlich auch „mitfühlen“. Indem er als „Ich“ spreche, ahme er menschliche Kommunikation nach und erzeuge den Eindruck, ein personales Gegenüber sei anwesend. Doch in Wahrheit sei dort niemand, der verstehe, zuhöre, da sei oder mitfühle. Anders als ein Mensch, der müde oder genervt sein könne oder keine Zeit habe, bleibe ein Chatbot stets verfügbar – er „schlafe und schlummere nicht“ (Psalm 121,4). Die Gefahr sei groß, dass Menschen angesichts dieser ständigen Verfügbarkeit und scheinbaren Dauer-Empathie die Kommunikation mit echten Menschen bald als unzulänglich empfänden.
ChatGPT erwecke den Eindruck, es sei das vertrauenswürdige, mitfühlende, verstehende Gegenüber, nach dem sich Menschen sehnten. Doch dort sei niemand. Dieses Vertrauen laufe ins Leere. In der Bibel heiße es treffend: Andere Götter seien Nichtse.

Hinter KI stünden keine ethischen Werte, sondern profitorientierte Unternehmen
Die „Werte“, an denen sich Künstliche Intelligenz orientiere, seien dabei keineswegs eindeutig. Hinter ihr stünden Unternehmen, die mit ihr Profit erzielen wollten. Je nach deren manipulativen Interessen könnten Daten so ausgewählt oder gefiltert werden, dass Rassismus oder Antifeminismus gefördert würden. KI könne – wie der gegenwärtige Informationskrieg in gefährdeten Demokratien zeige – dazu dienen, Ängste zu schüren, Ressentiments zu nähren und uns zu benebeln, wie Karl Schlögel es formuliert habe, so Tietze.
Man dürfe daher nicht naiv sein. Niemand solle sich vormachen lassen, bei KI handle es sich um eine von Natur aus „gute“ oder wenigstens „neutrale“ Macht. Man dürfe KI nicht die eigenen Urteile und ethischen Entscheidungen überlassen. Sonst „habe“ sie uns – und einige wenige Menschen „hätten“ uns durch sie. Das aber mache unfrei. Gott hingegen führe den Menschen in jene vielleicht mühsame, aber wahrhaft menschliche Freiheit, das eigene Leben selbst zu gestalten, sagte die Kirchenpräsidentin. (Vollständige Predigt hier).
Technik mit Weisheit nutzen, aber sie nicht anbeten

Kurzum: Künstliche Intelligenz kann uns in vielen Bereichen unterstützen: KI analysiert Daten, schreibt Texte, erkennt Krankheiten oder hilft ggfs. mehr oder weniger gute Entscheidungen zu treffen. Doch gerade weil KI so viel könne, besteht die Versuchung, ihr zu viel Macht zu geben – ihr zu vertrauen, als wisse sie, was richtig sei. Wenn wir KI als unfehlbar ansehen oder sie zu einer Instanz machten, die über Wahrheit, Moral oder den Wert des Menschen entscheidet, dann rückt sie in eine Rolle, die ihr nicht zusteht, ja für uns Menschen zur Gefahr werden kann, weil wir immer mehr unsere Selbstwirksamkeit und Selbstwahrnehmung verlieren. In diesem Moment kann KI zum „modernen Götzen“ werden – nicht aus Stein oder Gold, sondern aus Code und Algorithmen.
Das Erste Gebot ruft uns dazu auf, diese Grenze zu wahren. KI ist ein Werkzeug, kein Gott. Die Verantwortung für das, was wir tun und entscheiden, bleibt bei uns Menschen. Wenn wir unsere Verantwortung an Maschinen abgeben, wenn wir uns von ihnen mental abhängig machen und unser Denken beherrschen lassen, verlieren wir einen Teil unserer Freiheit und Menschlichkeit.
Das Erste Gebot nach fordert uns also auch dazu auf, uns bewusst zu bleiben: Wem oder was vertraue ich wirklich? Woher nehme ich Orientierung und Sinn? In einer Welt, in der Technik immer mächtiger wird, erinnert das Erste Gebot (2. Mose 20,2f): ,,Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir“, symbolisch daran, dass kein Algorithmus und keine Maschine (also zurück in die Knechtschaft) den Platz Gottes oder des menschlichen Gewissens einnehmen dürfe.
Fazit: KI darf beraten, unterstützen und erleichtern – aber nicht bestimmen, was gut und böse ist. KI darf Werkzeug in menschlich weiser Selbstbestimmung sein, nicht aber „Herr“, oder „Neben-Gott“ (Goldenes Kalb). Das Erste Gebot bleibt damit auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz nach 2700 Jahren aktuell: Nutze die Technik mit Weisheit, aber bete sie nicht an! „Lassen wir uns von KI nicht unsere Urteile und ethischen Entscheidungen abnehmen“, ermutigte Kirchenpräsidentin Prof. Dr. Christiane Tietz zum Selberdenken!
(Dokumentation Diether von Goddenthow – RheinMainKultur.de)
Evangelische Kirchen in Hessen Nassau
